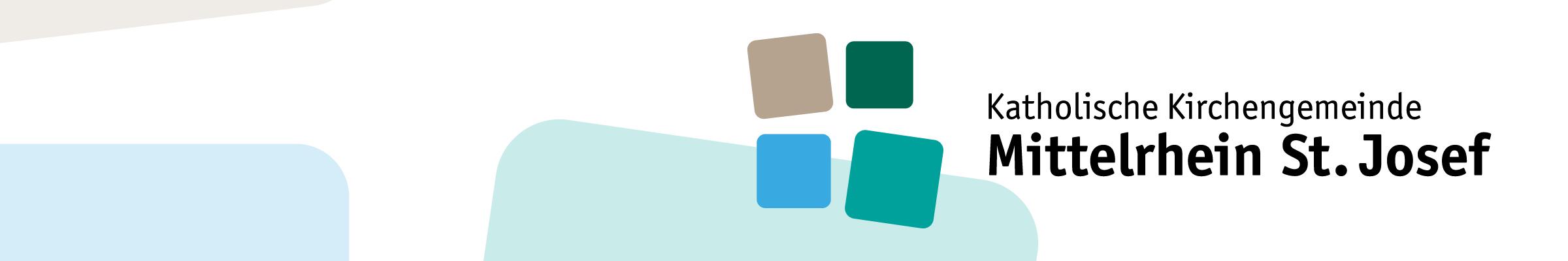Das Dorf Buchholz ist die erste urkundlich genannte Siedlung im Bereich der Pfarrei Herschwiesen. In dem "Schwedischen Krieg" ist auch die erste Kirche in Buchholz eingeäschert worden, wie uns das Visitationsprotokoll von 1657 mitteilt. Die Kirche war dem hl. Sebastian, der hl. Barbara und der hl. Katharina geweiht. In der folgenden Zeit ist zwar von einem Kapellenbau nichts bekannt, doch muß Anfang des 18. Jahrhunderts ein neues Gotteshaus in Buchholz gebaut worden sein, denn in den noch vorhandenen Jahresrechnungen ist von Gottesdiensten in der Kapelle zu Buchholz die Rede. Es werden auch mehrere Messestiftungen erwähnt, so 1753 zwanzig und 1769 fünfundzwanzig Wochen- und Jahresmessen.
Durch mündliche Überlieferung wird von einem Bittgang nach Bornhofen folgendes berichtet.
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Buchholz von einer schlimmen Viehseuche befallen, der die meisten Tiere zum Opfer fielen. Die Bewohner des Dorfes nahmen dieses Tiersterben als eine Heimsuchung Gottes an und gelobten öffentlich, zur Abwendung der Seuche am St. Anna-Tag eine Wallfahrt zur Marien-Gnadenstätte in Bornhofen zu unternehmen. So zog eine Prozession, an der die meisten Buchholzer bis auf die kleinen Kinder und Alten und Gebrechlichen teilnahmen, zum alten Wallfahrtsort am Rhein, um dort auf die Fürsprache der Schmerzhaften Muttergottes die göttliche Barmherzigkeit zu erflehen. Bei ihrer Rückkehr wurden die Wallfahrer schon im Bopparder Wald von den kleinen Kindern mit Jubel empfangen: "Unser Vieh ist gesund, es frisst wieder!"
Aus Dankbarkeit für diese Hilfe gelobten die Buchholzer, auch zukünftig jährlich am Anna-Tag nach Bornhofen zu wallfahrten. Das Versprechen wurde bis heute gehalten.
St. Sebastian
Die Buchholzer Filialkirche war im Laufe der Zeit so baufällig geworden, dass sie im Jahre 1888 baupolizeilich geschlossen und drei Jahre später abgerissen werden musste.
Gleich nach dem Abbruch wurde der Plan gefasst, eine neue Kirche zu bauen. 1892 kam es bereits zum Baubeginn. Noch im gleichen Jahr wurde die neue Kirche unter Dach gebracht. Doch dann ruhten die Arbeiten drei Jahre, da infolge der Mißernten 1892 und 1893 kaum Spenden für den Neubau eingingen.
Im Jahr 1895 ging man dann aber mit neuem Eifer an den Weiterbau, und am Fest des Dorfpatrons St. Sebastian, am 20. Januar 1896, konnte die neue Kirche in einer erhebenden Feier, die in der Schulchronik mit überschwenglicher Begeisterung geschildert wird, durch Pfarrer Peter Eberhardy aus Herschwiesen eingeweiht werden. Die vollständige innere Ausstattung erfolgte in den nächsten Jahren.
Im Jahr 1967, ergab sich die Notwendigkeit, durch den sprunghaften Anstieg der Einwohnerzahl in Buchholz, einen eigenen Seelsorgebezirk zu gründen und eine neue Kirche zu bauen. Am 14.02.1969 wurde Buchholz durch Anordnung von Diözesanbischof Dr. Bernhard Stein eine selbständige Kirchengemeinde.
Bereits am 02.03.1969 stellte Pastor Wiegand mit Adolf Mohr einen neuen Seelsorger in Buchholz vor, der am 23. März 1969 seinen ersten Gottesdienst in der Gemeinde feierte. In den Jahren 1974 bis 1976 baute die Pfarrei dann eine neue Pfarrkirche. Am 19.07.1974 erfolgte die Grundsteinlegung. Weihnachten 1975 konnte der erste Gottesdienst in der neuen Kirche gehalten werden und am 09. September 1979 nahm Weihbischof Karl-Heinz Jakoby aus Trier die feierliche Einweihung vor.
Im Herbst 1994 ging Pfarrer Adolf Mohr in den wohlverdienten Ruhestand und am 20. - 21. Mai 1995 wurde Pfarrer Walter Kanzler als neuer Pfarrer in Herschwiesen und Buchholz eingeführt.